|
EN BREF
|
In einem exklusiven Interview Antisemitismus setzt, da dieser zunehmend in der Gesellschaft verbreitet ist. Er diskutiert die Wichtigkeit, das Verhältnis zur jüdischen Gemeinschaft zu verbessern und die Null-Toleranz-Politik gegenüber Antisemitismus zu betonen. Des Weiteren äußert er sich kritisch zur BDS-Bewegung und erklärt, dass jegliche Organisation, die die Existenz Israels infrage stellt, keine staatliche Förderung erhalten sollte. Weimer betont, dass die Erinnerung an die NS-Zeit in Deutschland gestärkt werden muss und es notwendig ist, die Sichtbarkeit jüdischer Kultur zu erhöhen.
In einem exklusiven Interview gibt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer Einblicke in seine ersten Schritte im Amt, seine Position zu Antisemitismus und die Herausforderungen, die vor ihm liegen. Weimer betont die Wichtigkeit des Kampfes gegen Antisemitismus und stellt seine Pläne vor, um das Vertrauen der jüdischen Gemeinschaft zurückzugewinnen. Im Rahmen des Gesprächs diskutiert er auch den Umgang mit der BDS-Bewegung und die finanziellen Mittel zur Unterstützung der Gedenkstätten in Deutschland.
Ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus
Die erste Amtshandlung von Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister setzte ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus. Im Interview erläutert er seine Beweggründe für dieses Signal. Antisemitismus habe in unerträglicher Weise in unsere Gesellschaft Einzug gehalten und breche sich in verschiedenen Formen Bahn. Ob auf offenen Straßen, in versteckten Narrativen oder in Universitäten – der neue Antisemitismus sei omnipräsent. Besonders nach dem barbarischen Terrorangriff der Hamas auf Israel sieht Weimer eine zunehmende Zahl von Boykottaufrufen gegen jüdische Künstlerinnen und Künstler, die inakzeptabel seien. Für ihn ist es eine Frage der moralischen Integrität, dass Deutschland sich entschieden gegen solche Tendenzen positioniert.
Wiederaufbau des Vertrauens zur jüdischen Gemeinschaft
Die Beziehung zwischen der jüdischen Gemeinschaft und dem vorherigen Kulturstaatsministerium galt als zerrüttet. Weimer stellt klar, dass er die Vergangenheit nicht beurteilen möchte, aber bereit ist, eine konstruktive Zusammenarbeit zu fördern. Er hebt hervor, dass die Beziehung des BKM zur jüdischen Community wiederhergestellt werden muss und bekräftigt die Null-Toleranz-Politik gegen Antisemitismus. Die neue Bundesregierung und die höchsten Staatsvertreter haben sich klar positioniert und Wegweisungen für die gesellschaftlichen Normen formuliert, die diesen Kampf unterstützen.
Erstes Treffen mit Zentralratspräsident Josef Schuster
Wolfram Weimer beschreibt sein erstes Treffen mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, als ein bewusstes Signal der Solidarität. Das Gespräch war offen und vertrauensvoll und soll ein neuer Anfang in der Beziehung zwischen dem Kulturstaatsministerium und der jüdischen Gemeinschaft darstellen. Der Minister möchte diese konstruktive Linie fortsetzen und sieht hierin die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Einvernehmliche Vereinbarungen zur Restitution von NS-Raubgut
In dem Gespräch mit Schuster wurden mehrere zentrale Themen besprochen. Dazu gehört die Restitution von NS-Raubgut, die nach Weimers Ansicht verbessert werden muss. Hierfür haben sich Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände auf eine Reform der Beratenden Kommission verständigt, um die Schiedsgerichtsbarkeit weiterzuentwickeln. Dies soll den Zielen der Washingtoner Prinzipien besser dienen. Der Zentralrat war intensiv in den Reformprozess eingebunden.
Erinnerungs- und Förderkultur
Weimer und Schuster sprachen auch über das Rahmenkonzept für die Erinnerungskultur. Der Minister plädiert dafür, dass die Singularität des Holocaust in diesem Konzept deutlich zum Ausdruck kommt. Ein Raum für Relativismus darf hier nicht entstehen. Zudem möchten sie darüber diskutieren, wie jüdische Kultur in Deutschland sichtbarer gemacht werden kann, was auch die Möglichkeit von finanziellen Förderungen konkreter Projekte einschließt.
Die BDS-Bewegung und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen
Im Interview wird auch die BDS-Bewegung angesprochen. Laut Weimer brandmarkt der umfassende Boykottaufruf gegen Israel die jüdischen Staatsbürger als Ganzes und sei aus seiner Sicht inakzeptabel. Diese Betrachtung spiegelt sich auch in den politischen Stellungnahmen aller Parteien der Mitte wider, die die Boykottaufrufe scharf verurteilten. Er betont, dass Organisationen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen, nicht staatlich gefördert werden sollten. Es sei von großer Bedeutung, eine klare Haltung gegen jede Art von antisemitischen Bestrebungen einzunehmen.
Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft
Weimer hat in seinem Amtsantritt auch auf das umfangreiche und vielschichtige Problem des Antisemitismus in Deutschland hingewiesen. Er bezeichnet diese Herausforderung als ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nicht nur durch den zunehmenden Rechtsextremismus, sondern auch durch linksextreme und islamistische Bewegungen verstärkt wird. Der Minister hebt hervor, dass ein tief verwurzelter Hass auf Israel sowohl in der DDR als auch in der alten Bundesrepublik Ausdruck fand und bis heute nachhallt.
Finanzielle Unterstützung für Gedenkstätten
Ein wichtiger Punkt in den Gesprächen war die Stärkung der Gedenkstättenlandschaft in Deutschland. Weimer kündigt an, sich im Rahmen der bevorstehenden Haushaltsgespräche für eine Aufstockung der finanziellen Mittel einzusetzen.
Eine klare Positionierung für die Zukunft
Mit dem klaren Ziel, eine offene und solidarische Gesellschaft zu fördern, ist Weimer entschlossen, die Herausforderungen, die vor ihm liegen, aktiv anzugehen. In seinen ersten Monaten im Amt setzt er auf klare Botschaften und eine positive Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren in der Gesellschaft.
Schlussfolgerung: Zukunftsorientierte Kulturpolitik
Weimers Ansatz zur Kulturpolitik ist eine Mischung aus historischen Lehren und zukunftsorientierten Maßnahmen, die auf den Werten der Demokratie und des Zusammenhalts basieren. Der Minister hat sich stark dafür eingesetzt, die jüdische Kultur und die damit verbundenen Erinnerungen sichtbarer zu machen und Antisemitismus in all seinen Formen entschieden entgegenzutreten. Sein Stil ist klar, direkt und darauf ausgerichtet, positive Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen.
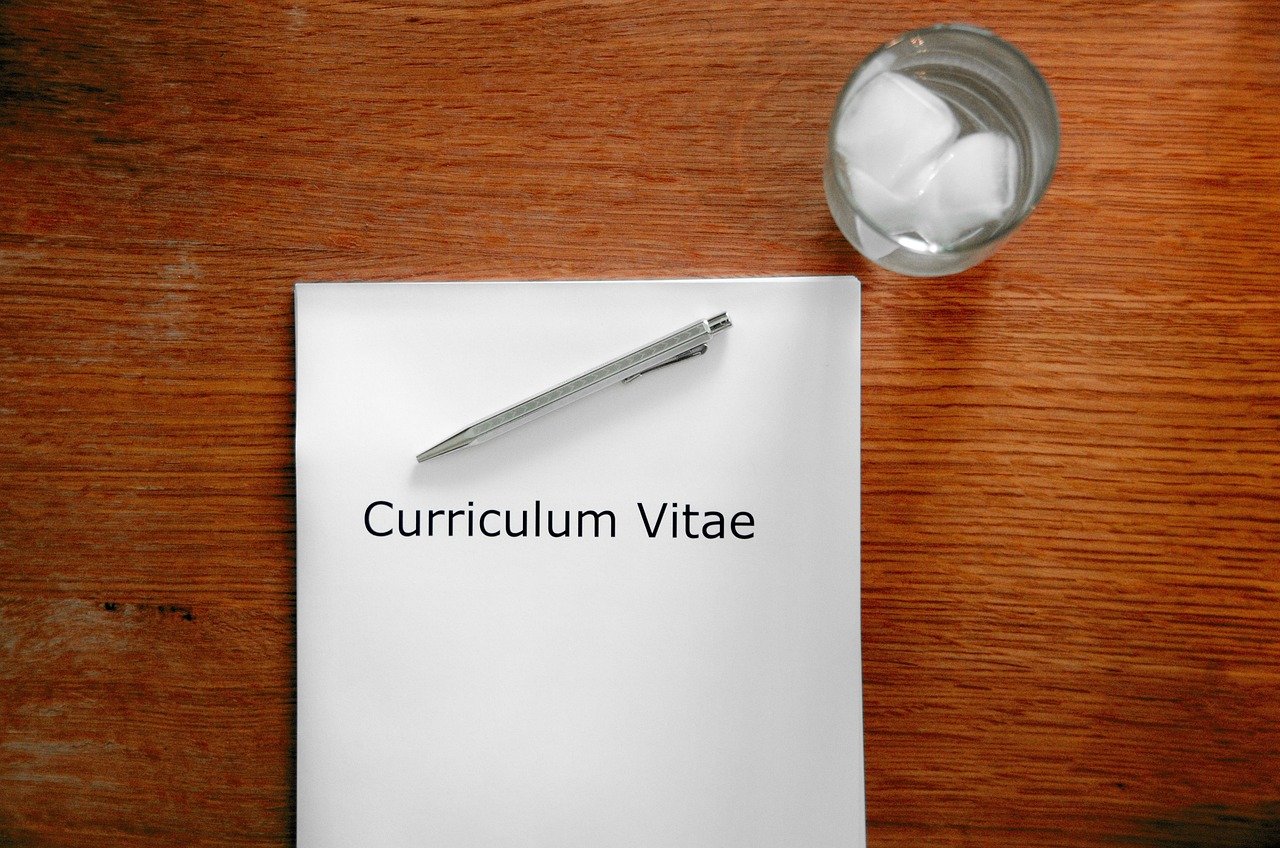
Wolfram Weimer hat zu Beginn seines Mandats als Kulturstaatsminister eine klare Null-Toleranz-Politik gegen Antisemitismus angekündigt. Diese Aussage zeigt die Dringlichkeit, mit der er das Problem angehen will. In einer Zeit, in der Antisemitismus in Deutschland zunehmend sichtbar wird, ist es von hoher Bedeutung, dass der Minister ein starkes und eindeutiges Signal sendet.
Ein zentrales Thema des Interviews war die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen dem Kulturministerium und der jüdischen Gemeinschaft. Weimer betont, dass es wichtig sei, die Beziehungen zu stärken und die Konflikte der Vergangenheit zu überwinden. Durch einen offenen Dialog und konstruktive Gespräche mit führenden Vertretern der jüdischen Gemeinschaft, wie Josef Schuster, möchte er eine neue, vertrauensvolle Zusammenarbeit fördern.
Das Gespräch mit Schuster war für Weimer von großer Bedeutung. Er beschreibt es als offen, vertrauensvoll und herzlich, was darauf hindeutet, dass er die persönliche Beziehung zu wichtigen Akteuren der jüdischen Gemeinschaft ernst nimmt. Zudem stellt er fest, dass in diesem Zusammenhang eine Reform der Restitution von NS-Raubgut gefordert ist, um die Anliegen der jüdischen Gemeinde besser zu unterstützen.
Ein weiteres wichtiges Thema war die BDS-Bewegung, die Weimer als antisemitisch einstuft. Er kritisierte, dass diese Bewegung nicht nur Israel, sondern auch israelische Künstler und Wissenschaftler angreift. Diese Äußerung unterstreicht seine Position, die besagt, dass solche Boykottaufrufe inakzeptabel sind und nicht von staatlicher Seite unterstützt werden sollten.
Weimer ist sich der unterschiedlichen Facetten des Antisemitismus in der Gesellschaft bewusst und thematisiert den Widerspruch, dass bestimmte Milieus Schwierigkeiten haben, Antisemiten als solche zu benennen. Seine Forderung steht im Einklang mit dem Ziel, das Bewusstsein für die verschiedenen Formen des Antisemitismus zu schärfen und eine breitere gesellschaftliche Auseinandersetzung anzuregen.
Abschließend lässt sich feststellen, dass Weimer durch seine erste öffentliche Stellungnahme und sein Engagement für die jüdische Gemeinschaft die Weichen für eine wichtige neue Ära in der Kulturpolitik stellen möchte. Sein Ansatz, bestehende Beziehungen zu stärken und aktuelle gesellschaftliche Probleme anzusprechen, könnte als grundlegender Schritt in die richtige Richtung angesehen werden.
